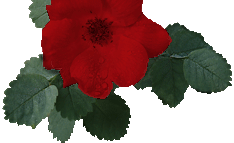Die Stoffe im Mittelalter
Eines der wichtigsten Wirtschaftszentren Europas während des Mittelalters neben Venedig war Nordwesteuropa. Für die oberdeutschen Kaufleute, insbesondere die Leinen- und Barchenthändler Schwabens, war die Donau der wichtigste Handelsweg nach dem Osten. Nach dem Süden gelangte man über die Tiroler Pässe nach Venedig (siehe Via Claudia Augusta). Bereits im 13. Jahrhundert wurde in Augsburg auch Baumwolle (vermutlich von den Arabern in Spanien und Sizilien ) verarbeitet. Nach dem venezianischen Geschichtsschreiber Marino soll zu Anfang des 14. Jhs. die Baumwolle in Venedig eingeführt worden sein, und sich von dort bald über die benachbarten italienischen Städte und später nach der Schweiz und nach Augsburg verbreitet haben.
Baumwolle
 Die Baumwolle ist kein einheimisches Material. Sie musste über einen
langen Weg zunächst aus dem Orient, meist über Italien und die
Schweiz, eingeführt werden. Daher spielte sie als Rohmaterial erst
ab dem 14. Jahrhundert eine gewisse Rolle in Mitteleuropa. Mit diesem
Rohstoff entwickelte sich die Heimindustrie, da sie keiner Zunftordnung
unterlag. Händler importierten die Baumwolle auf ihre Kosten, wie
z.B. Johannes Fugger aus Augsburg. Er war ein Leinweber, der vom Land
in die Stadt gekommen war und daher der Zunft nicht beitreten konnte.
So wagte er als erster in Deutschland um 1370 den Einkauf von größeren
Mengen Rohbaumwolle. Er ließ diese in Lohnarbeit verspinnen (Entstehung
des Verlagswesens!) und zu hochwertigem Barchent verweben. Das Verkaufen
der Stoffe besorgte er dann selbst. Die Familie Fugger wurde damit reich,
aber auch Venedig profitierte entsprechend. Bis ins 17. Jahrhundert führte
Augsburg die industrielle Massenproduktion von Baumwollstoffen an, danach
war es die flandrische und englische Baumwollindustrie mit eigenen Transportwegen
und Häfen.
Die Baumwolle ist kein einheimisches Material. Sie musste über einen
langen Weg zunächst aus dem Orient, meist über Italien und die
Schweiz, eingeführt werden. Daher spielte sie als Rohmaterial erst
ab dem 14. Jahrhundert eine gewisse Rolle in Mitteleuropa. Mit diesem
Rohstoff entwickelte sich die Heimindustrie, da sie keiner Zunftordnung
unterlag. Händler importierten die Baumwolle auf ihre Kosten, wie
z.B. Johannes Fugger aus Augsburg. Er war ein Leinweber, der vom Land
in die Stadt gekommen war und daher der Zunft nicht beitreten konnte.
So wagte er als erster in Deutschland um 1370 den Einkauf von größeren
Mengen Rohbaumwolle. Er ließ diese in Lohnarbeit verspinnen (Entstehung
des Verlagswesens!) und zu hochwertigem Barchent verweben. Das Verkaufen
der Stoffe besorgte er dann selbst. Die Familie Fugger wurde damit reich,
aber auch Venedig profitierte entsprechend. Bis ins 17. Jahrhundert führte
Augsburg die industrielle Massenproduktion von Baumwollstoffen an, danach
war es die flandrische und englische Baumwollindustrie mit eigenen Transportwegen
und Häfen.
Leinen
 Es
ist bekannt, dass unter anderem in Ägypten, Mesopotamien und Phönizien
bereits vor 6000 bis 7000 Jahren Leinen systematisch verarbeitet wurde.
Ägyptische Mumien sind in Leinenstreifen gehüllt. Möglicherweise existierte
die Leinenverarbeitung schon vor 10 000 Jahren. Von der griechischen und
römischen Antike bis ins europäische Mittelalter war Leinen neben Wolle
das Material für Kleidung. Seine Blütezeit hatte das Leinen im vorindustriellen
Europa. Als Baumwolle noch nicht in großen Mengen importiert wurde, war
Leinen (neben wenigen Ausnahmen) die einzige pflanzliche Faser. Bis Ende
des 18. Jahrhunderts waren 18 % der verarbeiteten Fasern aus Flachs und
78 % aus Wolle. Im Mittelalter wurde Leinen (im Gegensatz zu Wolle) durch
die schmutzabweisende Eigenschaft bevorzugt für körpernahe Verwendung
eingesetzt, auf Grund seiner Stärke auch für Stoffpanzer. Da es schwer
färbbar war, vorwiegend in blassen Tönen; deckende und dunkle Töne waren
teuer. Leinen wurde lange Zeit nur in Handarbeit verarbeitet, später kamen
auch industrielle Methoden hinzu. Bis ins 20. Jahrhundert wurde handgesponnenes,
aber auch maschinell versponnenes Garn in Heimarbeit auf Handwebstühlen
gewebt. Verarbeitet wurde das Leinen hauptsächlich in Irland, Holland,
Westfalen, Sachsen, Schlesien und Böhmen.
Es
ist bekannt, dass unter anderem in Ägypten, Mesopotamien und Phönizien
bereits vor 6000 bis 7000 Jahren Leinen systematisch verarbeitet wurde.
Ägyptische Mumien sind in Leinenstreifen gehüllt. Möglicherweise existierte
die Leinenverarbeitung schon vor 10 000 Jahren. Von der griechischen und
römischen Antike bis ins europäische Mittelalter war Leinen neben Wolle
das Material für Kleidung. Seine Blütezeit hatte das Leinen im vorindustriellen
Europa. Als Baumwolle noch nicht in großen Mengen importiert wurde, war
Leinen (neben wenigen Ausnahmen) die einzige pflanzliche Faser. Bis Ende
des 18. Jahrhunderts waren 18 % der verarbeiteten Fasern aus Flachs und
78 % aus Wolle. Im Mittelalter wurde Leinen (im Gegensatz zu Wolle) durch
die schmutzabweisende Eigenschaft bevorzugt für körpernahe Verwendung
eingesetzt, auf Grund seiner Stärke auch für Stoffpanzer. Da es schwer
färbbar war, vorwiegend in blassen Tönen; deckende und dunkle Töne waren
teuer. Leinen wurde lange Zeit nur in Handarbeit verarbeitet, später kamen
auch industrielle Methoden hinzu. Bis ins 20. Jahrhundert wurde handgesponnenes,
aber auch maschinell versponnenes Garn in Heimarbeit auf Handwebstühlen
gewebt. Verarbeitet wurde das Leinen hauptsächlich in Irland, Holland,
Westfalen, Sachsen, Schlesien und Böhmen.
Wolle
 Schafwolle
dürfte die älteste Bekleidungsfaser für die Menschen sein. Niemand kann
ein exaktes Datum angeben, wann der Mensch darauf gekommen ist, Schafwolle
für seine Bekleidung einzusetzen. Sicher ist nur, dass schon aus der Jungsteinzeit
(3000 bis 2000 vor Christus) Felszeichnungen vorhanden sind, die Schafe
darstellen. Nichtgeschorene Wildschafe wechseln jährlich ihr Fell. Sie
streifen sich die losen Haare an harten Gegenständen ( z.B. Bäumen) ab.
Dabei entstehen an diesen Gegenständen Wollstreifen, die sich, durch das
sich ständige Wiederholung des Abstreifens, zu langen Streifen zusammendrehen
können. Liegt hierin die Idee unserer Vorfahren die Schafwolle zu verspinnen?
Schafwolle
dürfte die älteste Bekleidungsfaser für die Menschen sein. Niemand kann
ein exaktes Datum angeben, wann der Mensch darauf gekommen ist, Schafwolle
für seine Bekleidung einzusetzen. Sicher ist nur, dass schon aus der Jungsteinzeit
(3000 bis 2000 vor Christus) Felszeichnungen vorhanden sind, die Schafe
darstellen. Nichtgeschorene Wildschafe wechseln jährlich ihr Fell. Sie
streifen sich die losen Haare an harten Gegenständen ( z.B. Bäumen) ab.
Dabei entstehen an diesen Gegenständen Wollstreifen, die sich, durch das
sich ständige Wiederholung des Abstreifens, zu langen Streifen zusammendrehen
können. Liegt hierin die Idee unserer Vorfahren die Schafwolle zu verspinnen?
Wolle verfügt über ein hohes Wärmerückhaltevermögen, da die Eiweißsubstanz
selbst ein schlechter Wärmeleiter ist und die Faser, bedingt durch Kräuselung
und Schuppenschicht, einen sehr hohen Lufteinschluss gewährleistet. Schafwolle
kann bis zu 30% ihres Gewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht
anzufühlen. Sie ist sehr luftdurchlässig, bauschfähig und besonders atmungsaktiv
durch die hohe Elastizität (Rückstellvermögen) der gekräuselten Faser.
sie verfügt über eine hohe Absorptionswirkung und gilt als raumluftverbessernd.
Schafwolle hat einen natürlichen Selbstreinigungseffekt, der aus der besonderen
Faserstruktur resultiert. Das Innere des Haares besteht aus zwei verschiedenen
Arten von Zellen. Diese leicht verzwirnten Hälften verhalten sich gegenüber
Feuchtigkeit unterschiedlich. Eine Zellart quillt stärker als die andere.
Da beide fest miteinander verbunden sind, sind sie ständig in Bewegung.
Die Wolle hat gute Trocknungseigenschaften, da die natürliche Fettschicht
Lanolin auf der Oberfläche der Faser eine schnelle Verdunstung gewährleistet.
In Nordeuropa stammen die ersten Wollfunde aus der Bronzezeit (ca 1500
v. Chr.). In der anschießenden Eisenzeit wurde die Woll - Schere erfunden.
Vorher wurden Schafe mit einem gebogenen Messer geschoren. Im Mittelalter
erlebte dann die Wollproduktion eine ungeheuere Blüte. Karl der Große
lies Wollmanufakturen errichten und förderte die Produktion.
Seide
 Seide
ist eine feine Textilfaser, die aus den Kokons der Seidenraupe, der Larve
des Seidenspinners, gewonnen wird. Sie ist die einzige in der Natur vorkommende
textile Endlos-Faser aus Eiweiß. Sie kommt ursprünglich vermutlich aus
China und war eine wichtige Handelsware, die über die Seidenstraße nach
Europa transportiert wurde. Neben China, wo auch heute noch der Hauptanteil
produziert wird, sind Japan und Indien weitere wichtige Erzeugerländer,
in denen der Seidenbau betrieben wird. Seide hat eine geringe Dichte,
so ist sie leicht, bequem und formbeständig. Sie isoliert sehr gut, ist
im Winter warm und im Sommer kühl. Seide kann sehr gut Farbstoffe aufnehmen,
hat einen "trockenen" Griff und - je nach Herstellungsart des Stoffes
- hat sie einen besonders schimmernden Glanz.
Seide
ist eine feine Textilfaser, die aus den Kokons der Seidenraupe, der Larve
des Seidenspinners, gewonnen wird. Sie ist die einzige in der Natur vorkommende
textile Endlos-Faser aus Eiweiß. Sie kommt ursprünglich vermutlich aus
China und war eine wichtige Handelsware, die über die Seidenstraße nach
Europa transportiert wurde. Neben China, wo auch heute noch der Hauptanteil
produziert wird, sind Japan und Indien weitere wichtige Erzeugerländer,
in denen der Seidenbau betrieben wird. Seide hat eine geringe Dichte,
so ist sie leicht, bequem und formbeständig. Sie isoliert sehr gut, ist
im Winter warm und im Sommer kühl. Seide kann sehr gut Farbstoffe aufnehmen,
hat einen "trockenen" Griff und - je nach Herstellungsart des Stoffes
- hat sie einen besonders schimmernden Glanz.
Verschiedene Arten von Seide:
Bouretteseide (Grobspinnverfahren aus kurzen Faserstücken)
Chappe- oder Schappeseide (aus Seidenabfällen)
Dupionseide (typische Unregelmäßigkeiten der Fäden)
Fagaraseide (Seide des Atlasspinners)
Haspelseide (von abgewickelten Endlosfäden)
Maulbeerseide (Seide des Maulbeerspinners)
Noileseide
Soupleseide (durch Seifenlauge teilweise entbastet)
Tussahseide (Seide des Japanischer Eichenseidenspinners)
Wildseide (von verschiedenen Seidenspinnern)
Nessel
 Stimmt
es, dass Brennnesseln als Rohstoff für Textilien verwendet werden?
Auch wenn es hautunfreundlich klingt, stimmt es: Aus Brennnesseln können
Textilien hergestellt werden. Was nicht stimmt, ist der vorschnelle Schluss,
dass Brennnessel-Kleidung kratzt, juckt und brennt. Im Gegenteil: Glatter
als Leinen und weicher als Seide sollen Stoffe aus der eher unbeliebten
Pflanze sein.
Stimmt
es, dass Brennnesseln als Rohstoff für Textilien verwendet werden?
Auch wenn es hautunfreundlich klingt, stimmt es: Aus Brennnesseln können
Textilien hergestellt werden. Was nicht stimmt, ist der vorschnelle Schluss,
dass Brennnessel-Kleidung kratzt, juckt und brennt. Im Gegenteil: Glatter
als Leinen und weicher als Seide sollen Stoffe aus der eher unbeliebten
Pflanze sein.
Die Idee, Brennnesseln als Rohstoff für Textilien zu verwenden, ist
alt: Bereits im Mittelalter wusste man, dass in der Rinde der Pflanzenstängel
Faserbestandteile stecken, die sich für die Garnherstellung eignen.
Die langen Bastfasern wurden durch Kochen in Lauge isoliert und zu so
genanntem Nesseltuch verarbeitet. Im 19. Jahrhundert verdrängte die
Baumwolle den Rohstoff Brennnessel. In Kriegszeiten war Baumwolle sehr
knapp, deshalb wurde die Brennnessel vorübergehend wiederentdeckt
und galt als das Leinen der armen Leute. Außerdem fertigte man Uniformen
daraus an.
Heute ist das Gewächs mit den Juckreiz auslösenden Härchen
allenfalls noch als Heilpflanze bekannt. Außerdem schätzen
Feinschmecker die jungen Triebe als spinatähnliches Wildgemüse.
Dass Brennnesseln auch als nachwachsender Rohstoff für textile Gewebe
in Frage kommen, ist eher unbekannt.
Dabei ist die vielerorts als lästiges Unkraut bekämpfte Pflanze
ein äußerst pflegeleichtes und damit wirtschaftliches Gewächs:
Ist sie erst einmal angewachsen, kann sie bis zu 20 Jahre lang ohne ständige
Neuanpflanzung geerntet werden. Sie ist anspruchslos und wächst auf
fast allen Böden. Auch auf Pflanzenschutzmittel kann verzichtet werden.
Denn zum einen schützt sie sich selbst vor unliebsamen Gästen
durch die in ihren Brennhaaren enthaltene Säure, zum anderen leben
Schädlinge und Nützlinge, die auf ihrem Grün zu Hause sind,
in einem ausgewogenen Verhältnis.
Im Gegensatz zur Baumwolle liefert sie zudem eine gleich bleibende Qualität.
Wichtig ist der Stamm der Pflanze, denn der enthält die meisten Fasern.
Brennnesselfasern sind lang und reißfest und daher sehr gut geeignet,
um daraus strapazierfähige und langlebige Kleidung herzustellen.
Ob eines schönen Tages aus Brennnesselstoff Massenware wird, bleibt
abzuwarten. Denn noch ist der Aufbereitungsprozess - der Weg von der Nessel
zum Stoff - relativ aufwendig. Viele Textilforscher sehen die Zukunft
der Brennnessel deshalb eher als Nischenprodukt, in etwa vergleichbar
mit Hanf.
Hanf
 Hanf
(Cannabis sativa) hat wie kaum eine andere Pflanze Geschichte geschrieben,
Kultur geschaffen und technischen Fortschritt eingeleitet. Er wird seit
ungefähr 10 000 Jahren genutzt und seit mindestens 3 000 Jahren in
allen Teilen der Welt angebaut. In China wurden vor fast 5000 Jahren die
ersten Textilien aus Hanffasern gewebt und vor über 2000 Jahren das
erste Papier aus Hanffasern geschöpft. weiblicher Hanfblütenstand
Über Jahrtausende gewann man aus Hanf wirksame Medizin, gesunde Nahrung,
wertvolles Öl für Farben und Lacke sowie Fasern für alle
Zwecke. Beispielsweise benutzten Gutenberg für den Buchdruck und
Rembrandt für seine Ölgemälde Hanfprodukte; denn aus Hanf
wurde sowohl zähes, dauerhaftes Papier als auch Farben hergestellt.
Die Seefahrt mit den großen Handels- und Entdeckungsreisen mit Segelschiffen
wären ohne Hanf nicht möglich gewesen. Taue, Seile, Schnüre,
Garne, Segeltuch und die erste Levi's Blue-Jeans, alles was reißfest
und geschmeidig zugleich sein sollte, konnte in dieser Qualität nur
aus Hanffasern gefertigt werden.
Hanf
(Cannabis sativa) hat wie kaum eine andere Pflanze Geschichte geschrieben,
Kultur geschaffen und technischen Fortschritt eingeleitet. Er wird seit
ungefähr 10 000 Jahren genutzt und seit mindestens 3 000 Jahren in
allen Teilen der Welt angebaut. In China wurden vor fast 5000 Jahren die
ersten Textilien aus Hanffasern gewebt und vor über 2000 Jahren das
erste Papier aus Hanffasern geschöpft. weiblicher Hanfblütenstand
Über Jahrtausende gewann man aus Hanf wirksame Medizin, gesunde Nahrung,
wertvolles Öl für Farben und Lacke sowie Fasern für alle
Zwecke. Beispielsweise benutzten Gutenberg für den Buchdruck und
Rembrandt für seine Ölgemälde Hanfprodukte; denn aus Hanf
wurde sowohl zähes, dauerhaftes Papier als auch Farben hergestellt.
Die Seefahrt mit den großen Handels- und Entdeckungsreisen mit Segelschiffen
wären ohne Hanf nicht möglich gewesen. Taue, Seile, Schnüre,
Garne, Segeltuch und die erste Levi's Blue-Jeans, alles was reißfest
und geschmeidig zugleich sein sollte, konnte in dieser Qualität nur
aus Hanffasern gefertigt werden.
Die Pflanze gedeiht in vielen Klimazonen der Erde und kommt ohne chemischen
Pflanzenschutz aus. Sie ist höchst produktiv und liefert vielseitig
genutzte Rohstoffe mit einer sehr guten Ökobilanz. Und dennoch konnte
Hanf, der noch bis ins 20. Jahrhundert hinein unersetzlich schien, in
der westlichen Welt verboten, verteufelt und nahezu vergessen werden.
Warum erregte die Pflanze plötzlich soviel Gegenwehr?
Quellen: Wikipedia und Eigene