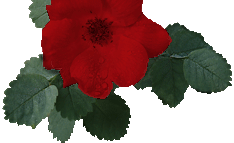Theophanu, eine verehrungswürdige Frau
Theophanu, auch Theophano oder Theophania (geboren ca. 955 oder früher im oströmischen Reich; nach Krankheit am 15. Juni 991 in Nimwegen gestorben), sie war eine byzantinische Prinzessin und wurde, durch Vermittlung des Kölner Erzbischofs Gero am 14. April 972 zur Gemahlin Ottos II. und Mitkaiserin des Heiligen Römischen Reiches für 11 Jahre und Kaiserin für 7 Jahre. Sie war eine der einflussreichsten Herrscherinnen des Mittelalters und steht in der Herrscherfolge des Kaiserreichs zwischen Otto II. und Otto III.
Kinder
Aus der Ehe gingen 5 Kinder hervor:
Adelheid, Äbtissin von Quedlinburg
Sophia, Äbtissin von Gandersheim und Essen
Mathilde, spätere Ehefrau von Pfalzgraf Ezzo
Kaiser Otto III.
vermutlich noch eine Zwillingsschwester Ottos III., für die Otto
II. direkt nach der Geburt eine Totenmesse abhalten ließ.
Politischer Einfluss einer Frau im Mittelalter?!
Der Hochzeitsurkunde der Theophanu ist zu entnehmen, dass sie bei ihrer
Heirat in Rom vom Papst zur Kaiserin gekrönt wurde. In den Urkunden
Ottos II. wird Theophanu oft erwähnt (etwa in einem Viertel aller
Urkunden), was ihr bevorzugtes und einflussreiches Interesse an den Angelegenheiten
des Reiches bezeugt. Sie war zu ihrer Zeit sicherlich die reichste Frau
des Kaiserreichs.
Nachdem Otto II. am 7. Dezember 983 überraschend an Malaria gestorben
war, rief Willigis, der Erzbischof von Mainz, Theophanu und Adelheid,
Ottos II. Mutter, aus Italien nach Deutschland. In Rara (Rohr bei Meiningen)
übergab 984 Heinrich von Bayern (der Zänker), der nächste
männliche Verwandte der herrschenden Dynastie, der deshalb Ansprüche
auf die Vormundschaft und Regentschaft erhob, den schon zum König
gekrönten unmündigen dreijährigen Otto III. an Theophanu.
Im Mai 985 wurde Theophanu in Frankfurt am Main endgültig die Herrschaft
zugesprochen, es bahnte sich die Erblichkeit der Krone im Reich an. Zur
gleichen Zeit regierten Theophanus Brüder in Konstantinopel, das
Kaisertum von Ost und West lagen für einen Moment der Weltgeschichte
in den Händen einer Herrscherfamilie. Theophanu war bis zu ihrem
Tod 991, dem Höhepunkt ihrer Macht, Regentin des Heiligen Römischen
Reichs.
Sie festigte zusammen mit ihrer Schwiegermutter Adelheid die Reichsherrschaft
insbesondere in Lothringen und Italien, aber auch an der slawischen Ostgrenze
(986 erschienen nach mehreren Feldzügen der Kaiserin die Slawenfürsten
Böhmens und Polens in Frieden zum Hoftag zu Quedlinburg). Durch ihre
kluge Machtpolitik gelang es ihr, ihrem Sohn Otto III. den Kaiserthron
zu sichern.
Theophanu ließ offizielle Dokumente in Ausübung ihrer Regierungsgewalt
ausstellen und durchbrach damit die politischen Wirkungsmöglichkeiten
der Kaiserinnen des Heiligen Römischen Reiches des 10. und 11. Jahrhunderts.
In der Ravennater Urkunde vom 1. April 990 signierte sie in byzantinischer
Tradition als Kaiser (nicht als Kaiserin), eindrucksvoll als Theophanius
gratia divina imperator augustus - Theophanius, durch göttliche Gnade
erhabener Kaiser.
Mode, Kunst und Kultur
Gerade in der Zeit um 1000 orientierte sich die Kunst im Reich an byzantinischen
Vorbildern (Buchmalerei, Goldschmiedekunst); Theophanu brachte aus Konstantinopel
ein Gefolge aus Künstlern, Architekten und Kunsthandwerkern mit,
durch die sich u. a. der Einfluss der byzantinischen Künste im Reich
verbreitete. Weiterhin lässt sich die Verbreitung des Nikolausbrauchtums
auf Theophanu zurückführen.
Ebenfalls auf Theophanu ist der Einfluss auf die Mode zurückzuführen.
Sie war ein schönes und sich gerne schmückendes Mädchen
und als Prinzessin auch in der Lage dieses (Frauen) Bedürfnis zu
leben und weiter zu entwickeln und sich dementsprechend mit dieser Mode
zu umgeben.
15. Juni 991
Die Kaiserin starb nach kurzer Krankheit am 15. Juni 991 in Nimwegen und wurde auf ihrem Witwensitz in Köln in der Abteikirche St. Pantaleon bestattet. Nach dem Tode Theophanus konnte ihre Schwiegermutter, die Kaiserin Adelheid, ohne Schwierigkeiten die Regentschaft für den Enkel Otto III. bis Ende 994 weiterführen.
Grabstätte St. Pantaleon in Köln
Theophanu wurde auf eigenen Wunsch im Westwerk von St. Pantaleon (Köln)
beigesetzt (einer ihrer Lieblingsheiligen war der heilige Pantaleon,
einer der 14 Nothelfer). 
Ihre letzte Ruhestätte fand sie (nach mehreren Umbettungen) in dem
von Sepp Hürten neu gestalteten Sarkophag aus weißem Naxos-Marmor,
in den am 28. Dezember 1962 ein Bleibehälter mit den wenigen sterblichen
Überresten der Kaiserin eingebettet wurde. An der Stirnseite des
Sarkophages ist in Anlehnung an das rechts abgebildete Elfenbeinrelief
des 10. Jahrhunderts ein das Herrscherpaar krönender und segnender
Christus zu sehen mit der Hagia Sofia aus Konstantinopel und Sankt Pantaleon
aus Köln als Symbol der geeinten Kirche zu Ottos II. und Theophanus
Zeiten, verbunden aber auch mit dem heutigen Wunsch nach Einigkeit. Der
Sarkophag wird von folgender Schrift umgeben: Domina
Theophanu, Imperatrix, uxor et mater Imperatoris, quae basilicam sancti
Pantaleonis summo honore coluit et rebus propriis munificenter cumulavit,
hic sepulcrum sibi constitui iussit (Kaiserin Theophanu, Gattin
eines Kaisers und Mutter eines Kaisers, die dieser Kirche des hl. Pantaleon
besondere Gunst erwies und sie aus ihrem Besitz großzügig beschenkte,
ließ sich an dieser Stelle bestatten).
Theophanu und die Gegenwart
Seit 1989 findet jährlich am 15. Juni, dem Todestag Theophanus, am Sarkophag der Kaiserin eine Eucharistiefeier für die Einheit der Christen in Ost und West statt, deren kirchliche Einheit 1054 auseinanderbrach. Um St. Pantaleon gibt es Bestrebungen zur Heiligsprechung Theophanus; auch werden Gebete und Kerzen zum privaten Gebrauch an ihrem Grabmal angeboten.
Quellen: Wikipedia und Eigene

14 Nothelfer
>>>
mehr