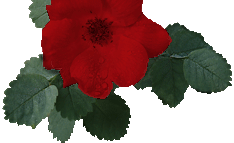Schönheit im Mittelalter
Anders als in späteren historischen Epochen – etwa der Zeit Ludwigs XIV., in der versucht wurde unangenehme Körpergerüche bzw. – ausdünstungen mit Parfüms und Pülverchen zu übertünchen – nahm die Körperpflege im Mittelalter einen sehr hohen Stellenwert ein. Das tägliche Bad war nur für die Ärmsten nicht erschwinglich. Für Adlige war es üblich, zumindest einmal pro Tag ein Bad zu nehmen. Am Berufsbild des Baders zeigt sich sehr gut, dass Körperpflege von Medizin nicht getrennt wurde und für die mittelalterliche Gesellschaft von großer Wichtigkeit war. Beim Bader handelte es sich um einen Mitarbeiter, oft auch um den Betreiber einer Badestube. Sein Tätigkeitsbereich umfasste sowohl medizinische als auch hygienische und kosmetische Aufgaben.
 Neben
der reinen Körperpflege wurde auch sehr viel Wert auf Kosmetik gelegt.
Nach dem Waschen wurden sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die
Wangen und Lippen geschminkt. Sehr beliebt war zur damaligen Zeit der
rote Farbstoff der Schildlaus. Haare wurden gefärbt, gebleicht oder
gekräuselt, die Augenbrauen wurden in die richtige Form gebracht
und es wurde fleißig mit diversen Geruchsölen (Lavendel, Rose)
parfümiert. Blasser Teint galt als Zeichen höchster Eleganz
und war damit in Adelskreisen ein absolutes Muss. Um die Blässe zu
bewahren wurden Gesichtsdampfbäder genommen – anschließend
daran wurde mit weißer Schminke auf der Basis von Weizenschrot oder
Bleiweiß nachbehandelt. Auch die Hände und Fingernägel
wurden einer besonderen Pflege unterzogen. So trugen etwa adlige Spanierinnen
im 14. Jahrhundert rund 20 cm lange Fingernägel, die einer speziellen
Politur unterzogen wurden.
Neben
der reinen Körperpflege wurde auch sehr viel Wert auf Kosmetik gelegt.
Nach dem Waschen wurden sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die
Wangen und Lippen geschminkt. Sehr beliebt war zur damaligen Zeit der
rote Farbstoff der Schildlaus. Haare wurden gefärbt, gebleicht oder
gekräuselt, die Augenbrauen wurden in die richtige Form gebracht
und es wurde fleißig mit diversen Geruchsölen (Lavendel, Rose)
parfümiert. Blasser Teint galt als Zeichen höchster Eleganz
und war damit in Adelskreisen ein absolutes Muss. Um die Blässe zu
bewahren wurden Gesichtsdampfbäder genommen – anschließend
daran wurde mit weißer Schminke auf der Basis von Weizenschrot oder
Bleiweiß nachbehandelt. Auch die Hände und Fingernägel
wurden einer besonderen Pflege unterzogen. So trugen etwa adlige Spanierinnen
im 14. Jahrhundert rund 20 cm lange Fingernägel, die einer speziellen
Politur unterzogen wurden.
Die Haarmode
 Die
Haarmode unterlag während des Mittelalters diversen Modeströmungen
und war regional sehr unterschiedlich. Gleichzeitig war sie vor allem
Angelegenheit des Adels. Mit Eiweiß und Brenneisen wurden die Haare
gelockt oder gekräuselt. Für zu dünnes Haar gab es einige
Tricks bzw. Hilfsmittel um Fülle vorzutäuschen: So wurden etwa
Seiden- oder Goldfäden ins eigene Haar eingeflochten. Für kahlköpfige
Herren wurden kurzerhand Perücken hergestellt.
Die
Haarmode unterlag während des Mittelalters diversen Modeströmungen
und war regional sehr unterschiedlich. Gleichzeitig war sie vor allem
Angelegenheit des Adels. Mit Eiweiß und Brenneisen wurden die Haare
gelockt oder gekräuselt. Für zu dünnes Haar gab es einige
Tricks bzw. Hilfsmittel um Fülle vorzutäuschen: So wurden etwa
Seiden- oder Goldfäden ins eigene Haar eingeflochten. Für kahlköpfige
Herren wurden kurzerhand Perücken hergestellt.
Im Spätmittelalter nahmen die Frisuren des Adels immer kuriosere
Formen an – neben dem Flechten der Haare zu kunstvollen Haarmuscheln
wurden unter der Verwendung von Haarnetzen auch Walzen, Kugeln oder etwa
Hörner aus dem Haupthaar geformt. – Dies ergab ein für
heutige Augen sehr buntes Bild, das sich dem Betrachter bei damaligen
Gesellschaften geboten hat. Hier ein kleines Rezept zum Blondieren des
Haares.
Ein Rezept aus dem Mittelalter für blondere Haare
Zutaten:
10 gehäufte Esslöffel Kamillentee
1 ½ Liter Wasser
2 Esslöffel Apfelessig
Das Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Wenn das Wasser
zu kochen beginnt, den Kamillentee hinzufügen. Den Tee 10 Minuten
kochen lassen und weitere 10 Minuten ziehen lassen. Den Sud mit einem
großen Sieb abseihen und kalt stellen. Schließlich den Apfelessig
hinzufügen. Vor dem Schlafengehen die Haare im Waschbecken im Kamillensud
baden, danach ein altes sauberes Geschirrtuch um Kopf und Haare wickeln
(der Kamillensud färbt ab), schließlich ein Handtuch darüber
knoten. Den Kamillensud über Nacht einwirken lassen.
In der Früh mit lauwarmem Wasser ausspülen und die Haare mit
einem milden Shampoo waschen. Eine schnellere Möglichkeit:
Den Sud samt Teeblättern noch warm am Kopf verteilen, die Haare in
Tücher wickeln und den Sud zwei Stunden einwirken lassen.
Tipp:
Die Haare nach dem Färben mit Haarbalsam behandeln.
Blondiermittel nicht in die Augen bringen, und wenn, rasch ausspülen.
Enthaarung
Für die Enthaarung empfiehlt sich ein sehr preiswert und recht einfach herzustellendes Mittel: Halawa (arab.: von „süß“ abgeleitet). Es besteht einfach aus Zitronensaft und Zucker, gern auch etwas Honig. An der Dosierung muss man selbst etwas experimentieren. Ausprobiert: 2 kleine Becher Saft und 1,75 Becher Zucker. Die Zutaten lässt man etwa eine halbe Stunde ganz leise köcheln, sie karamelliesieren. Unbedingt umrühren, durch den Zucker neigt das Ganze gern zum Anbrennen. Danach am besten in ein breites Gefäß zum Verschließen füllen, die Menge reicht eine Weile. Vorsicht, diese bonbonähnliche Masse ist sehr heiß!!! Nach dem Abkühlen sollte sie eine zähe Konsistenz haben. Etwa ein bonbongroßes Stück abzupfen, eventuell etwas durchkneten und dünn in Wuchsrichtung der Haare auf die Haut streichen. Danach entgegen der Wuchsrichtung mit dem Fingerrücken das Halawa mit kurzen Bewegungen abstreifen. Haare und abgestorbene Hautschüppchen werden entfernt. Besonders gut eignet sich die Methode für die Beine, denn die Haut muss wirklich straff sein. Das nachwachsende Haar ist dann schon spärlicher und man fühlt nicht so diese lästigen Stoppeln. Nach der Anwendung am besten die Haut nochmal mit warmem Wasser abwaschen und ein Pflegemittel auftragen. Es gibt verschiedene Beschreibungen zur Herstellung und Anwendung von Halawa. Ich habe sie selbst wie beschrieben in Syrien kennengelernt. Dort wurde sie für jegliche Körperbehaarung verwendet.
Halawa ist ein seit langem bekanntes Körperenthaarungsmittel im Orient. Der Islam schreibt den Gläubigen eine regelmäßige Enthaarung des Körpers, insbesondere der Achselhöhlen und des Intimbereichs, vor. Da bei der Bevölkerung des Nahen Ostens und Nordafrikas die Körperbehaarung häufig dichter und kräftiger ist als bei nördlichen und ostasiatischen Völkern, konnten sich andere Methoden der Körperenthaarung wie das Auszupfen mit Pinzetten nicht auf Dauer durchsetzen.
Der „Bader“ und sein Werk:
Zum Einnehmen des Bades wurden Badezuber verwendet – diese entsprechen von der Konstruktion her einem halben stehenden Fass. Zur Bequemlichkeit der Badenden wurden die Badezuber oft mit Stoff ausgepolstert. Zusätzlich dazu gab es noch Holzauflagen, die das Essen während der Einnahme eines Bades ermöglichten und so das größt mögliche Wohlbefinden garantierten. Die öffentlichen Badestuben waren vor allem für Menschen der Unterschicht gedacht, die sich die Einrichtung eines eigenen Bades nicht leisten konnten.
 Es
gab keine Trennung der Geschlechter. Angesichts dessen und auch angesichts
der Tatsache, dass in den Bädern reichlich gegessen, getrunken und
gefeiert wurde, waren die öffentlichen Bäder der Kirche bald
ein Dorn im Auge. Die Besitzer der Badestuben waren hoch angesehene Mitglieder
der Gesellschaft – Bischöfe und Landesherren. Auf der einen
Seite traten sie gegen den moralischen Verfall an, andererseits profitierten
sie von den Gewinnen aus den Badestuben. Vom Standard her erreichten die
öffentlichen Badestuben nie die geistlichen bzw. ritterlichen Badestuben.
Bader und Mägde hatten umfangreiche Aufgaben. Sie wurden aber schlecht
bezahlt. Bademägde waren gleichzeitig auch Prostituierte in den Badestuben.
Erst spät erfolgte die Trennung in Frauen- und Männerbäder;
Baderegeln wurden erstellt. Im selben Ausmaß wie diese Regulationen
in Kraft traten, ging das Interesse an den öffentlichen Bädern
zurück.
Es
gab keine Trennung der Geschlechter. Angesichts dessen und auch angesichts
der Tatsache, dass in den Bädern reichlich gegessen, getrunken und
gefeiert wurde, waren die öffentlichen Bäder der Kirche bald
ein Dorn im Auge. Die Besitzer der Badestuben waren hoch angesehene Mitglieder
der Gesellschaft – Bischöfe und Landesherren. Auf der einen
Seite traten sie gegen den moralischen Verfall an, andererseits profitierten
sie von den Gewinnen aus den Badestuben. Vom Standard her erreichten die
öffentlichen Badestuben nie die geistlichen bzw. ritterlichen Badestuben.
Bader und Mägde hatten umfangreiche Aufgaben. Sie wurden aber schlecht
bezahlt. Bademägde waren gleichzeitig auch Prostituierte in den Badestuben.
Erst spät erfolgte die Trennung in Frauen- und Männerbäder;
Baderegeln wurden erstellt. Im selben Ausmaß wie diese Regulationen
in Kraft traten, ging das Interesse an den öffentlichen Bädern
zurück.
Aufgaben des Baders
Zur-Ader-Lassen:
Der Aderlass war eine Standardheilmethode, die meist zur Behandlung aller
Krankheiten eingesetzt wurde. Mit einer Fliete, einem Messer ähnlichen
Gegenstand, wurde dem Patienten eine Vene geöffnet, um die Krankheit
mit dem Blut herausfließen zu lassen. Welche Vene an welcher Stelle
geöffnet wurde, hing von der Stellung der Gestirne, des Mondes und
von der jeweiligen Jahreszeit ab.
- Behandlung von Kopfschmerzen
- Anlegen von Verbänden
- Ausgabe von Salben und Arzneien
- Ziehen kranker Zähne (siehe Bild oben)
- Heilen von Geschwüren und Wunden
- Ausübung kleiner chirurgischer Tätigkeiten, Massage
- Schneiden der Haare und des Bartes
- Bereitstellung des Bades
- Betreuung der Badegäste
(Aus dem Hohelied Salomos)